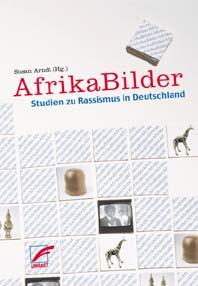»Neue Fragen an den Klassiker der antikolonialen Revolutionstheorie aus subjektkritischer Perspektive.« konkret
“Udo Wolter trifft die Grundbegriffe der Fanonschen Theoriebildung. Das Buch wird für das Fanon-Verständnis … und für die Forschung fortan unverzichtbar sein.”
Oskar Lubin, GWR 264
Frantz Fanon, der am 6. Dezember 2001 vierzig Jahre tot sein wird, hat bis zu seinem frühen Tod an Leukämie in nur einem knappen Jahrzehnt intensiven Schaffens ein bis heute umstrittenes Werk hinterlassen. Durch seine Biographie wie durch seine Schriften wurde er zu einem Symbol des revolutionären Kampfes der “Verdammten dieser Erde” gegen koloniale und imperialistische Unterdrückung schlechthin. Die durch den zitierten Titel seines Hauptwerkes sprichwörtlich gewordene Bedeutung Fanons für den revoltutionären Befreiungskampf der “Dritten Welt” führte nicht nur in der deutschen Linken vor allem nach ’68 zu einer ikonenhaften und selektiv auf die Legitimation des bewaffneten Kampfes gerichteten Fanon-Rezeption. Mit dem Niedergang der nationalen Befreiungsbewegungen und des klassischen Antiimperialismus schien dann seine Theorie in der Linken, in Deutschland jedenfalls ausserhalb antiimperialistischer Rest-Zusammenhänge, seit Ende der 80er Jahre etwas in Vergessenheit zu geraten.
Das sollte sich allerdings im Laufe der 90er Jahre mit dem Aufkommen der “Postcolonial Critique” als linker Theorieströmung an den anglo-amerikanischen Universitäten wieder ändern. Deren zunehmende Rezeption durch Teile der deutschen Linken führte auch hierzulande in den letzten Jahren zu einem beträchtlichen Fanon-Revival. So finden sich heute regelmäßig Fanon-Zitate in Texten von Linken, die sich an Poststrukturalismus und Praktiken kultureller Subversion orientieren und mit dem alten linksradikalen Antiimperialismus höchstens eine ausgeprägte gegenseitige Abneigung teilen. In Anlehnung an einen Aufsatz von Stewart Hall läßt sich daher die Frage formulieren, von der eine Untersuchung wie die hier vorgestellte auszugehen hat: warum ausgerechnet Fanon, und warum gerade heute? Die Diskussion der Bedeutung Fanons in diesem Buch bezieht sich daher wesentlich auf die seit Beginn der 90er Jahre des gerade zuende gegangenen Jahrhunderts intensiv und kontrovers geführte Debatte um Fanon in der “postcolonial Critique”.
Angesichts des Fanon-Booms in den “postkolonial Studies” stellt sich präziser formuliert die Frage, wieso eigentlich ein Theoretiker, der gemeinhin als Klassiker der antikolonialen Revolutionstheorie der 60er Jahre gilt, heute auch und gerade von denjenigen in Anspruch genommen wird, welche die bipolaren Entgegensetzungen Kolonialherr/Kolonisierter, Westen/Rest, Zivilisation/Wildheit, männlich/weiblich etc., ebenso wie die repressiven Festschreibungen ethnischer und nationaler Identitäten dekonstruktivistisch auflösen wollen in eine fließende, “hybride” Subjektivität als Grundlage neuer kultureller und politischer Formen widerständigen Handelns. Und nicht nur von diesen, sondern auch von ihren eher marxistisch argumentierenden KritikerInnen. Da letztere zumeist auch auf die eine oder andere Weise stärker an einem Projekt nationaler Befreiung entsprechenden Marxismus-Versionen festhalten, betrifft die Auseinandersetzung mit der vornehmlich anglo-amerikanischen Postkolonialismus-Debatte indirekt auch die traditionelle Fanon-Exegese deutscher AntiimperialistInnen. Wie konnte Fanon also zu einem Begründer des Antikolonialismus und eines anti-begründungslogischen (anti-foundationalist) Postkolonialismus zugleich werden?
Wenn die Rede auf Fanon kommt, scheint oft sein Leben und seine Person schon die halbe Erklärung für seine Wirkung zu sein: Gemäß den Vorlieben der heutigen postkolonialen Fanon-Interpreten wird dann gelegentlich auch auf seinen gründlich gemischten, sprich “hybriden” Familienhintergrund aus Nachkommen in die Karibik verschleppter Sklaven ebenso wie indischen und europäischen Vorfahren verwiesen. So fragwürdig es scheint, Fanons Theorie aus einer ‘gemischtrassigen’ Herkunft erklären zu wollen, so sehr siedelt ihn doch seine Biographie tatsächlich in vieler Hinsicht auf der Grenze zwischen den Welten an, welche er vor allem als manichäisch entgegengesetzte analysieren sollte: Schwarz und Weiß, Kolonisatoren und Kolonisierte. Als Sohn einer mittelständischen und auf Assimilierung orientierten Familie lernte Fanon auf Martinique die rassistische Hierarchie einer kolonialen Gesellschaft kennen, aber auch die Annahme des eigenen Schwarzseins als Identität durch seinen Lehrer und Freund Aimé Césaire, dessen Négritude-Konzept er später allerdings scharf kritisieren sollte. Während seines psychiatrischen Studiums in Frankreich war er mit dem Rassismus der europäischen Metropole konfrontiert, welcher ihn aus genau der Kultur ausschloß, der er sich in ihren universellen humanistischen Idealen verbunden fühlte, und um deren Verteidigung willen er als 19-jähriger freiwillig mit der französischen Armee in den Krieg gegen die deutsche nationalsozialistische Barbarei gezogen war. Fanon lehnte einen schwarzen Ethnozentrismus ab und stellte selbst den Anfang seines kämpferischen Engagements genau in diesen Zusammenhang, als er schrieb: “Was soll dieses Gerede von einem schwarzen Volk, einer Negernationalität? Ich bin Franzose.[…]Als Menschen […] in Frankreich eingefallen sind, um es zu knechten, da wies mich mein Stand als Franzose darauf hin, daß mein Platz nicht neben dem Problem, sondern mitten in dem Problem war.” In gewissem Sinn befand sich Fanon, als französischer Staatsbürger aus Martinique, der sich im Prozess der formalen Dekolonisation mitten ins Handgemenge begeben hatte, auch auf der historischen Grenze zwischen Kolonialismus und der heute ausgerufenen Postkolonialität. Nicht zuletzt diesen Erfahrungen dürfte also die enorme Vielschichtigkeit von Fanons Werk geschuldet sein.
Bei den Auseinandersetzungen um die Fanon-Rezeption zwischen den poststrukturalistisch argumentierenden VertreterInnen der “postcolonial Critique” und ihren KritikerInnen ist des öfteren die Tendenz unverkennbar, den “psychologisierenden” oder “kleinbürgerlichen” Fanon des frühen Buches “Schwarze Haut, weiße Masken” als Fanon der Poststrukturalisten gegen den “revolutionären” der “Verdammten dieser Erde” als Fanon der marxistischen Antiimperialisten auszuspielen. Ich denke, daß dies bei Fanon schon angesichts der kurzen Zeitspanne seines Schaffens noch weniger Sinn macht als bei anderen AutorInnen. Im Gegensatz zu solchen willkürlichen und letztlich aus Abgrenzungsbedürfnissen entspringenden Trennungen bin ich der Auffassung, daß sich in Fanons Werk durchaus Kohärenz und eine stringente Umsetzung seiner bereits früh entwickelten Grundannahmen nachweisen läßt.
Entscheidend für eine angemessene Analyse von Fanons Werk ist die bei ihm durchgängig zentrale Kategorie der Subjektivität, und gerade hier liegt auch seine Attraktivität für die postkoloniale Rezeption. Vor allem deshalb ist sein erstes Buch “Schwarze Haut, weiße Masken” heute stärker in den Mittelpunkt der Diskussion geraten als die “Verdammten dieser Erde”. Fanon entwickelt hier sein ganzes, auch für seine späteren Schriften prägendes kategoriales Arsenal auf der Subjektebene psychosexuell-affektiver und diskursiver Prozesse, mit oft nah bei den heutigen Poststrukturalismen liegenden theoretischen Bezügen.Die einzelnen Analysen in diesem Buch werden sich daher immer wieder um diese Kategorie gruppieren und die Konsequenzen zu zeigen versuchen, die sich aus Fanons hegelianisch an der Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft sowie an Sartres Existentialismus orientierten Übertragung der Subjekt-Perspektive auf die Ebene kollektiver Identitäten und kollektiven politischen Handelns ergeben. Bei letzterem hat vor allem in der Rezeption der siebziger/achtziger Jahre Fanons unbedingte Befürwortung der Gewalt im antikolonialen Kampf kontroverse Reaktion