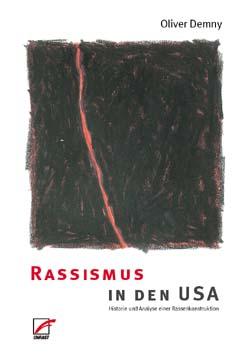Oliver Demny – Autor von Die Wut des Panthers – versucht hier keine offizielle lineare Geschichtsschreibung zu liefern, sondern eine Geschichtsschreibung ‘von unten’ zu verknüpfen mit einer Alltags- und Sexualitätsgeschichte, die Brüche aufzeigt und die Wurzeln heutiger Auseinandersetzungen in den USA zwischen den ‚Rassen’ beleuchtet.
Gegen den Stillstand in der Rassismusanalyse hierzulande versucht der Autor, einen neuen theoretischen Rahmen anhand des konkreten Beispiels USA zu entwickeln, der modifiziert auch auf andere Phänomene anwendbar wäre. Dabei versucht Demny mit Rückgriffen auf Foucault und Eklektizismen auf Luhmanns Systemtheorie zu erklären, was nicht ist und gleichzeitig ist: die Rasse und das Geschlecht, und wie darüber ‚fatale Identität‹ hergestellt wird.
Rezension Jungle World
Weißer Cowboy, schwarzer Sklave
Oliver Demnys Studie »Rassismus in den USA« beschreibt, wie das Konstrukt der Rasse das Amerikanische definierte: Es führte eine hierarchische Unterscheidung ein.
von daniel hajdarovic
Wer hat das nicht schon erlebt? Nach einem Gespräch mit einer nicht näher bekannten Person ist man unschlüssig, ob sie eine Brille auf der Nase hatte oder nicht. Bewusst wird einem das erst, wenn eine dritte Person fragt: »War das der/die mit der Brille?« Mit der Hautfarbe des Gegenübers verhält es sich anders, die haben wir sofort abgespeichert. Dieses Beispiel soll illustrieren, dass sich in der Moderne nicht etwa das Tragen einer Brille, wohl aber die Hautfarbe als signifikantes Merkmal für die Identität eines Menschen durchgesetzt hat. »Ich weiß dank der Hautfarbe«, schreibt der Soziologe Oliver Demny, »wer die andere Person ist.« Und wer ich selbst bin. Frappierend an dieser intellektuell eigentlich unbefriedigenden Reduktion von Komplexität ist, dass auch die Überzeugung, einen Menschen nicht nach solchen Kriterien bewerten zu können, die Klassifizierung nicht aufhebt.
Dafür ein Beispiel: Michael Jacksons Hautfarbe wird immer heller. Trotzdem bleibt auch der hellhäutige Jackson in der öffentlichen Wahrnehmung ein Schwarzer; eben ein Schwarzer, der sich die Haut bleicht. Neben der tatsächlichen Hauttönung kommt also im Code des Rassismus die unveränderliche Abstammung ins Spiel. »In den USA zählen alle, die einen einzigen weit entfernten schwarzen Vorfahren haben, nach dem Grundsatz des einzigen Tropfens Blut, der ‘one-drop-rule’, als Schwarze.«
Demny geht dem Ursprung dieses starren binären Systems, das Übergänge oder »Buntheit« ausschließen soll, auf den historischen Grund. Dabei zeigt seine Arbeit »Rassismus in den USA. Historie und Analyse einer Rassenkonstruktion«, wie tief dieses Gedankengut in den Denkmustern des modernen Subjekts verwurzelt ist. Erst im Zuge der Aufklärung, »im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert, entstand die moderne Rasse«.
»Rasse« verwendet Demny stets ohne Anführungszeichen. Das ist nicht unproblematisch, soll aber die Wirkungsmacht des Wahns aufzeigen. Dass »Rassen« in einem wissenschaftlich-biologischen Sinn nicht existieren, nimmt soziologisch betrachtet der »Rasse« als existierendem Konstrukt ja nichts von seiner Realität. (Übrigens lässt der angelsächsische Diskurs dem Begriff race auch keine Gänsefüßchen angedeihen. Ein kleines Symbol für das Dilemma, in dem der Kampf gegen die Diskriminierung von Minderheiten in den USA steckt. Die Forderung nach Quoten für verschiedene races ist ebenso eine Notwendigkeit wie gleichzeitig eine Bestätigung der Klassifizierung selbst.)
Indem Demny an den historischen Anfang eines biologistischen Rassenbegriffs zurückgeht, den er bei François Bernier 1684 findet, kommt er auch auf das Spezifikum der sich herausbildenden modernen Wissenschaften zu sprechen. Der aus einer »gottgewollten« Ordnung entlassene Mensch entwickelt nun rational begründete, auf Herrschaft ausgerichtete Ordnungsschemata.
Freilich geraten diese häufig eher »ratioid«, um die geniale Wortschöpfung Robert Musils zu verwenden. Denn die neue Herrlichkeit des Subjekts ist gefährdet, wenn nicht alles und jedes in seine Klassifikationsmuster eingepasst wird. Den Zwang zur Suche nach einer Identität als Folie, auf der alles abzubilden und zu integrieren sein soll, skizziert Demny im Rekurs auf Michel Foucault und Angelika Magiros und fasst die Omnipotenz des modernen Subjekts so zusammen: »Es gibt kein anderes mehr, alles ist gleich. Aber es ist eben doch nicht alles ganz gleich, manches weicht ab, ist pathologisch. Anderes wird dem Gleichen also dadurch einverleibt, dass es zu einer Abart des Gleichen deklariert wird.«
Als »Abart« des Normalen dient in den USA die afro-amerikanische Bevölkerung. Dieser Gegenpol, an dem sich die eigene Identität qua Abgrenzung bildet, verhalf dem Einwanderungsland USA zu einer gewissen Homogeniät. Ob italienisch-, griechisch-, oder irischstämmig: Die ganze weiße Vielfalt amerikanisierte sich auf Kosten von »Uncle Tom«, einte sich im gemeinsamen Gefühl rassischer Überlegenheit.
Demny vergleicht diese Rassenkonstruktion mit einem anderen identitätsstiftenden Mechanismus: mit der modernen Erfindung des Geschlechts. So wie das Merkmal Hellhäutigkeit zur Norm erklärt wird, von der alle Definitionen abgeleitet werden, ist »Männlichkeit« eine primäre Konstruktion, schreibt Demny. »Menschen werden demnach als Frauen dann wahrgenommen, wenn sie nicht als Männer wahrgenommen werden können.« Neben der Konstruktion einer Differenz produziert diese Ableitung vor allem eine Rangfolge. Das Patriarchat ist zwar älter als die Aufklärung, aber erst mit der Moderne entstand das »eindeutige Geschlecht« mit seinen rigiden Zuschreibungen.
Für die Phase, die den festgezurrten Identitätszwängen vorausging, führt Demny historische Beispiele an, die sowohl Geschlecht als auch Rasse und als Drittes die sexuelle Orientierung betreffen. Damit ist die Foucaultsche Trias der zentralen Zutaten einer modernen »Matrix der Identität« komplett. Bevor Heterosexualität und die auf Nachwuchs angelegte Familie zur ausnahmslosen Norm wurden – wie weiß und männlich zu Attributen der Höherwertigkeit -, existierte beispielsweise die so genannte Bostoner Ehe, das Zusammenleben zweier Frauen, und auch ansonsten die Liebe und Freundschaft zweier Frauen. Im liberalen Boston war dies bis ins 19. Jahrhundert hinein »akzeptierter Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens«.
Zur gleichen Zeit gab es schwarze Cowboys, sie stellten jeden fünften Mann in dieser Berufsgruppe. Dass die Rinderherden auch von ihnen durch den Wilden Westen getrieben wurden, ist deshalb von Bedeutung, weil der Mythos vom amerikanischen Kuhhirten – die Verklärung von Freiheit, Tapferkeit und edelherber Männerfreundschaft – bis heute als sinnstiftendes Identifikationsmuster der Nation fungiert. Die von Demny angeführten Quellen und die Tatsache, dass zur Linken und zur Rechten von John Wayne stets nur Bleichgesichter im Sattel sitzen, lässt wieder nur eine Interpretation zu. Die Definition des genuin Amerikanischen vollzieht sich unter Ausschluss der Afro-Amerikaner, die als das schlechthin Andere implizit zur Selbstvergewisserung beitragen.
In der Cowboy-Romantik erinnert so wenig an die »schwarzen Anteile«, wie umgekehrt das Wissen um die Sklaverei vom Bild des weißen Sklaven bereinigt ist. Demny zeigt, dass vor der Erfindung des biologischen Rassenbegriffs die »Versklavungswürdigkeit« eines Menschen nicht automatisch an dessen Hautfarbe gekoppelt war. Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts gab es auch weiße Sklaven, entweder verurteilte Sträflinge oder europäische Auswanderer, die ihre Schiffspassage in die Neue Welt nur bezahlen konnten, indem sie sich zum Sklavendienst bereit erklärten. Befristet war dieser Status auf sieben Jahre, was auch für die ersten Generationen der aus Afrika verschleppten Menschen galt. Deshalb