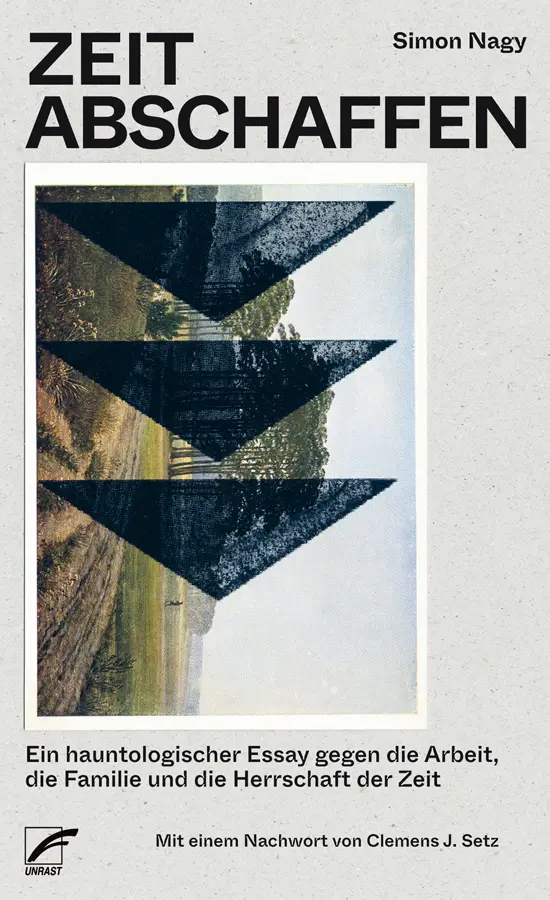»Nagys intensiver Fisher-Lektüre ist es zu verdanken, dass er nicht bei dessen letztlich oberflächlicher Derrida-Lektüre stehen bleibt, sondern den Anstoß zu einer ›dialektischen Hauntologie‹ gibt. Sie interessiert sich, so Nagy, für die Momente, in denen sich die beiden Wirkrichtungen des ›no longer‹ und des ›not yet‹ verschränken – Momente, ›in denen vergangene und zukünftige Gespenster miteinander ins Gespräch treten‹. Gerahmt wird dieses Vorhaben von einem Dreisprung, der bei der Kritik der linearisierten Zeit, wie sie der Kapitalismus hervorgebracht hat, einsetzt (…). Dies führt Nagy (mit Moshe Postone) zur Kritik der Arbeit im Rahmen der kapitalistischen ›Ökonomie der Zeit‹ – die nach Marx in der linearisierten gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit das Größenmaß ihrer (Mehr-)Wertproduktion hat. (…) Was hier unheimlich theorielastig klingt, liest sich in Nagys Essay herrlich unprätentiös und nachvollziehbar. In vielen kurzen und leichtfüßigen Beobachtungen an (pop-)kulturellen Phänomenen von Videospielen wie Super Smash Bros. über Filme wie Bong Joon-hos Parasite bis zu Romanen wie Hari Kunzrus White Tears präsentiert Nagy Teaser einer dialektischen Hauntologie, die im Überlagern von ›no longer‹ und ›not yet‹ den Spuk als revolutionäres Versprechen erkennt. Dass man die Analysen gerne etwas mehr ausgeführt gesehen hätte, spricht nicht gegen das Buch, sondern für sein anregendes Potenzial.« − Sebastian Kugler, Tagebuch, Februar 2025