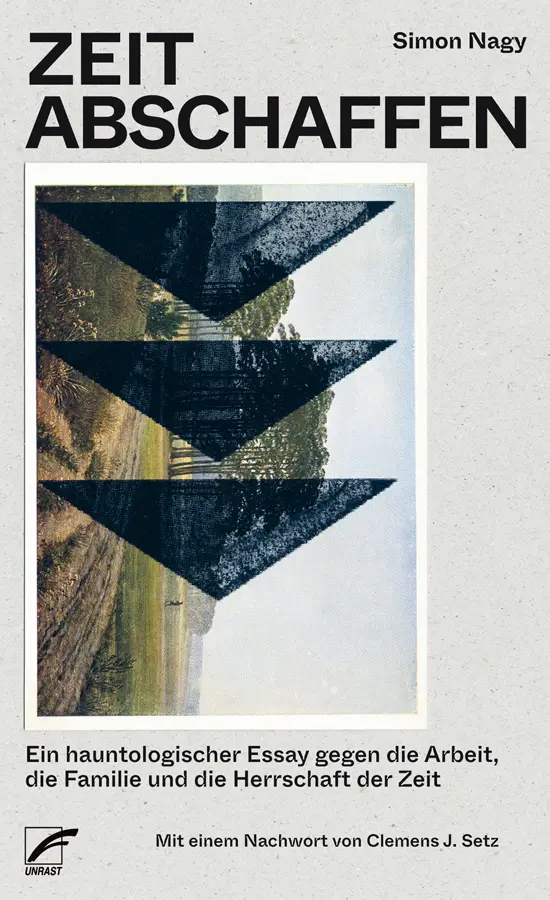»Die Vergangenheit schiebt und schiebt und man kaut noch auf der Gegenwart rum, da wird einer durch das Eintreffen der Zukunft der letzte Bissen Hier und Jetzt madig gemacht. (…) Wie Simon treffend in den einführenden Passagen seines Essays schreibt, ignoriere ich den Geist bzw. die Geister daher beharrlich, obwohl er mir im Nacken sitzt. Die Gespenster, schreibt er, seien größtenteils gar nicht unsichtbar. (…) Und dennoch täten wir fortlaufend so, als ob es sie nicht gäbe, anstatt und zu ihnen zu verhalten. (…) Der von Simon beschriebene Spuk, der als Metapher für neoliberale Verhältnisse unserer Gesellschaft dient, ist ein mir bekannter Geist. (…) Mit Zeit abschaffen führt Simon uns Leser:innen mittels resonierender Beispiele aus Popkultur und Zeitgeschichte ein in das dialektische Stahlbad der Gefühle und realen Verhältnisse und ruft auf zur Hoffnung in der totalen Hoffnungslosigkeit. Die Liste kluger Geister, die in diesem Band herumspuken dürfen, liest sich schwungvoll: Silvia Federici, Karl Marx und Friedrich Engels, César Aira, Jacques Derrida, Sophie Lewis, Bini Adamczak, Herbert Marcuse, Gilles Deleuze und Félix Guattari, Dietmar Daht, Tina Turner, Fred Moten, Anderas Peham und Moishe Postone, um nur einige zu nennen. Unbeeindruckt vom Schwergewicht ihrer Ideen für die (spät-)kapitalistische Theoriewelt seziert Simon ihre Gedanken, arrangiert sie zu einem fragmentarischen Mosaik in fünf Kapiteln. Die konkreten Ziele, die er ins Visier nimmt, sind nicht weniger als das Triumvirat des Kapitalismus: Die bürgerliche Kleinfamilie, die Lohnarbeit, die (neoliberale) Einhegung der Zeit. (…) Der Spuk wird wohl niemals enden, denn er hat sich als Fetisch in alles eingenistet. Als negative Erfahrung der Differenz jedoch können die Geister in den Rollen des ›Not-yet‹ oder ›No-longer‹ als patenter aber durchschaubarer Taschenspieler:innentrick des neoliberalen Spätkapitalismus enttarnt werden.« − Anne Zühlke, Malmoe, Januar 2025