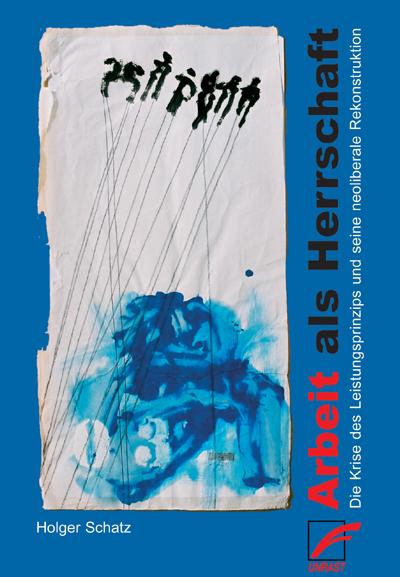»Das Leistungsprinzip, also die Ableitung individuellen Status und Einkommens aus individueller Leistung, ist als Phänomen der Moderne eng mit der Reduzierung der Arbeit auf Lohnarbeit verbunden. Alles menschliche Tun – so die Basis des Leistungsprinzips – ist mess- und vergleichbar; jeder bekommt, was er verdient! Indem es derart die Möglichkeiten sozialen Aufstiegs individualisiert, individualisiert das Arbeits- und Leistungsprinzip zugleich das Schicksal derer, denen dieser Aufstieg verwehrt blieb. Nur die Hegemonie einer solchen Auffassung macht erklärbar, warum soziale Ungleichheit in einer Gesellschaft als akzeptabel, gar als gerecht empfunden wird. Das Leistungsprinzip hat also in dieser Perspektive die Integration einer antagonistischen, kapitalistisch organisierten Gesellschaft sicherzustellen, es ist in diesem Sinn systemstabilisierend.
Nur, fragt Schatz: ist es dazu noch in der Lage? Der Glaube an das Leistungsprinzip schwindet zusehends. Angesichts herrschender technologie-induzierter Massenarbeitslosigkeit können viele ihre Leistungsfähigkeit gar nicht mehr unter Beweis stellen, zudem wird – infolge zunehmender Arbeitsteilung und steigenden gesellschaftlichen Wissens – der Zusammenhang von eigener Leistung und Ergebnis ohnehin immer unbestimmbarer. Um dennoch weiterhin systemstabilisierend wirken zu können, muss das Leistungsprinzip selbst immer wieder stabilisiert und rekonstruiert werden. (…) In diesem Sinne der Basisdisziplinierung mittels Leistungsprinzip wird die spezifische Logik im Kapitalismus sichtbar: Arbeit ist – als Instrument der sozialen Kontrolle – (nicht immer persönliche, aber immer abstrakte) Herrschaft. (…) Konsequenterweise ergibt sich für Schatz aus dieser Stärkung des Leistungsprinzips schließlich auch, dass wir von einer Entkopplung von Arbeit und Einkommen (z. B. im Rahmen eines Grundeinkommens) weiter denn je entfernt sind.« − Thilo Fehmel, Soziologische Revue, Bd. 29 H. 2, Februar 2006