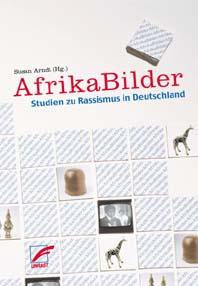‘Die Herausgeberin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Afrikawissenschaften der Humboldt-Universiät zu Berlin (Abt. Afrikanische Literaturen und Kulturen). Ihr im Herbst erschienener Band setzt sich zu einem großen Teil aus Gastvorträgen zusammen und teilt sich auf in Geschichte und Formen von Rassismus und „Rechtsextremismus“, Artikel über konkrete Afrikadarstellungen sowie Themen aus Politik und Nichtregierungsorganisationen (NROs).
Wenn Afrika-Bilder die Bilder sind, die nach der Weiterverarbeitung von Darstellungen Afrikas tatsächlich in den Köpfen bleiben, so geht es in dem Band nicht um die Bilder, also das Endergebnis, sondern um die Darstellungen Afrikas, also den Input, auch wenn diese Darstellungen natürlich durch die Bilder in den Köpfen derer, die Afrika jeweils darstellen, geprägt sind. Befragungsergebnisse zu Bildern und Einstellungen bei Menschen in Deutschland sind also beispielsweise nicht zu finden.
Wo besteht der Zusammenhang zwischen der praktischen Afrika-Politik auf der einen, hiesigen Afrika-Darstellungen und Rassismus auf der anderen Seite? Kann es den Leuten in Afrika nicht egal sein, wie verzerrt sie hier dargestellt werden? Die Herausgeberin zeigt in ihrer umfassenden Einleitung mit Impressionen aus dem deutschen Afrikadiskurs noch einmal auf, dass beide, Politik und Diskurs, zusammengehören und einander beeinflussen. Der erste und dritte Teil leisten allgemeine Hintergrundarbeit: Themen sind u.a. Darstellungsstrukturen in Medien, die Neuen Bundesländer, Schwarze Deutsche und ihre Familien, Migration und Asyl. Zu den bekannten Namen gehören May Ayim, Christoph Butterwegge, Barbara John, Ralf Koch, Siegfried Jäger. Der zweite Teil widmet sich konkreten Afrikadarstellungen: Themen sind hier Filme der NS-Zeit (Nganang), deutsche Filme und Serien bis heute (Baer), Kinder- und Jugendliteratur (Bräunlein), afrikanische Literatur und der Umgang mit ihr in Deutschland (Riesz, Ripken), Völkerkundemuseen (Ivanov) und wissenschaftlicher Rassismus (AG gegen „Rassenkunde“).
Herausragend in diesem zweiten Teil und insgesamt ist in den Augen der Rezensentin Paola Ivanov zu „Aneignung. Der museale Blick als Spiegel der europäischen Begegnung mit Afrika“. Die ihrer Wissenschaft gegenüber äußerst (selbst-)kritische Völkerkundlerin, Lehrbeauftragte an der Universität München und noch frische Absolventin eines zweijährigen Volontariats am Berliner Ethnologischen Museum, führt durch die Epochen musealer – und ethnologischer – Aneignung Afrikas in Deutschland bis heute und analysiert deren Ziele und Auswirkungen. Die Museen, so stellt sie fest, sind mit verantwortlich für das negative Image Afrikas und seiner Menschen. Was gesammelt wird und wie es ausgestellt wird, richtet sich nach der eigenen Wahrnehmung und den eigenen Zielen der Verantwortlichen, ist also subjektiv. Doch dieses Materielle mit seiner geordneten Ausstellungsweise und Beschriftung erscheint als objektives Zeugnis. Die Wurzeln für die allgemeine „überbordende Sammelleidenschaft“ liegen im 16./17. Jahrhundert, also im Erkundungs- bzw. Eroberungszeitalter. Man eignete sich „die Welt im materiellen und geistigen Sinne an und demonstrierte deren Besitz“. Die Autorin zeigt, dass speziell aus Afrika im 15. und 16. Jahrhundert einige Pretiosen gesammelt wurden, das Interesse dann aber erst wieder, und überhaupt so richtig, kurz vor der Kolonisierung einsetzte, als ob sich in der Zeit dazwischen, der des transatlantischen Sklavenhandels nämlich, „das Interesse für Afrika im Entwenden von Menschen erschöpft hätte.“
Der kolonialen Aneignung ging die museale (und die „wissenschaftliche“) Aneignung voraus. Die Afrika-Reisenden waren als „Bezwinger des dunklen Erdteils“ gefeierte Helden, so Ivanov. Besonders gerne zeigten sie sich auf Photos mit den Waffen der Afrikaner, und so taten es auch die Museen; Afrika war in diesen Inszenierungen wild, gefährlich – und bezwungen. Das nützliche Bild vom geschichtslosen Kontinent, dessen Vergangenheit lediglich ziellos kriegerisch und statisch gewesen sei, wurde bestätigt. Neben Waffen waren in der Kolonialzeit „Fetische“ besonders beliebt, wobei die Reisenden dieses Schlagwort bald fast allen Darstellungen von Menschen und Tieren zuordneten, so dass es in den Inventarbüchern vor „Fetischen“ nur so wimmele, was heute nur in Einzelfällen noch zu korrigieren sei bei den auch sonst oft falsch kategorisierten Gegenständen. Die komplexen Religionen Afrikas blieben den Reisenden verborgen, die Fetischisierung kam in Europa anscheinend allen entgegen.
Nicht nur wurde Kunst aus Afrika lange nicht neben Kunst aus Europa ausgestellt und wird, weiterhin, die Geschichte Afrikas nicht neben der Geschichte Europas gezeigt, statt dessen dies alles in Museen, die für angeblich Geschichts- und Kunstlose konzipiert waren, sondern es ist noch schlimmer, wie die Autorin hervorhebt: Traditionell wurden, und werden teilweise bis heute, Afrikas Kulturen – wie Europa sie versteht – zusammen mit seiner Natur ausgestellt und damit als solche gar nicht anerkannt, etwa an so prominenten Orten wie dem American Museum of Natural History und Tervuren. Oder Afrikas Geschichte wird in Museen für Vorgeschichte gezeigt. Beide Darstellungsstrukturen finden in Schulbüchern, Medien etc. ihre Entsprechungen und sind kein Zufall: „Das Interesse galt also von vornherein nicht den lebenden Menschen und den aktuellen Kulturen (…) die Erzeugnisse und ihre Produzenten wurden de facto in die Vergangenheit projiziert, was ein Verstummen lassen der lebenden Afrikaner und die Verweigerung der Beziehung mit ihnen zur Folge hatte.“ Dazu gehört auch, dass in dem Bemühen, ein „traditionelles“, also die Idee des „authentisch“ primitiven und statischen Afrika darzustellen, neue Materialien und Formen bei den Sammlern verpönt waren, urbane Entwicklungen bewusst übersehen und lieber Masken gekauft wurden, die nie getragen sondern extra zum Verkauf angefertigt worden sind – aber den Vorstellungen der Käufer entsprachen, einmal abgesehen davon, dass sie unafrikanisch ausgestellt wurden, das Wesentliche, die eigentliche Inszenierung und Kunst, fehlte.
Individualität der Künstler und Künstlerinnen wurde dabei nicht in Betracht gezogen, sondern Beschriftungen wie „Figur, Chokwe, Angola“, auch für künstlerisch individuell geprägte und hochwertige Objekte, ethnisieren bis heute, obwohl dies wissenschaftlich nicht haltbar ist. Deprimiert stellt Ivanov abschließend fest, dass die Integration afrikanischer Kunst in die europäische Kunstszene durch Picasso und Kollegen auch nicht zu größerem Respekt gegenüber Afrika geführt habe, weil die nur sahen, was sie sehen wollten, nämlich die „reine Form“. Man verachtete die Objekte nicht mehr, weil man sie als „primitiv“ ansah, sondern man bewunderte sie aus demselben Grund – und ließ sich inspirieren. Vielleicht darf die Rezensentin abschließend den Blick auf hoffentlich zukunftsweisende Ausstellungen wie jene von ca. 80 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, darunter große Namen, aus Senegal 1990 in Paris lenken, als Beispiel dafür, wie Europa wieder lernen kann, zuzuhören.
Die AG gegen „Rassenkunde“, und damit zurück zu einigen besonders empfehlenswerten Artikeln des Sammelbandes, wurde 1995 als Initiative von Studierenden an der Universität Hamburg gegründet, um auf die „Rassekunde“-Vorlesungen am Humanbiologischen Institut ihrer Universität öffentlich aufmerksam zu machen. Autorinnen und Autor des Artikels (Britta Bergmann, promoviert in Medizin, Johann Knigge, Diplom-Politologe und Leiter internationaler Jugendseminare zu Rassismus-Themen, Ruth Stiasny, Diplom-Sozialwissenschaftlerin) analysieren biologistisch-rassistische, sexistische und andere diskriminierende, wissenschaftlich heute nicht mehr haltbare Inhalte aus der Lehre des Instituts und den Publikationen der Lehrenden, geben Beispiele und erläutern Hintergründe zu Tradition und heutigem Personal des Instituts. Über die Ergebnisse ist bundesweit berichtet worden, geändert hat sich anscheinend wenig, so wenig wie in vielen Lehrplänen und Schulbüchern zu dem Thema.
Peter Ripken, der Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. (Frankfurt/M.), erläutert in seinem Artikel die besonderen Schwierigkeiten in Deutschland mit der Rezeption afrikanischer Literatur und geht dabei auf Strömungen und eine ganze Reihe einzelner Werke genauer ein. Er tut dies kenntnisreich, mit so viel Schwung und Liebe, dass bei der Lektüre wohl nicht nur die Rezensentin weitere Anregungen und eine unbändige Lust bekommt, sich bald wieder in Sprach-, Denk- und Erlebniswelten nigerianischer, malischer und anderer Autorinnen und Autoren hineinzulesen. János Riesz geht in der Betrachtung der „unterbrochenen Lektion“ u.a. seiner These nach, dass die zahlreichen deutschen Autorinnen, auch Autoren, die Romane über Afrika bzw. mit afrikanischer Kulisse schreiben, das vorhandene Interesse an Literatur über Afrika aufsaugen und damit Übersetzungen afrikanischer Autoren und Autorinnen auf dem deutschen Markt verdrängen.
Die beiden Artikel, die den Band abschließen, sind von Gerd Poppe über Menschenrechte in Afrika bzw. die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung und von Cord Jakobeit über die sogenannte Entwicklungshilfepolitik. Poppe, einer der bekanntesten Vertreter der DDR-Opposition, ist seit 1998 Beauftragter des Auswärtigen Amtes für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Seine diplomatischen Ausführungen eigneten sich vorzüglich als Hochglanzbroschüre für das Amt. Das Gegenteil trifft zu auf die fundierten und sehr kritischen Ausführungen des Direktors des Instituts für Afrika-Kunde in Hamburg, Jakobeit. Der Professor für Politische Wissenschaft zeigt die erschütternde Bilanz von 40 Jahren „Entwicklungszusammenarbeit“ mit Afrika auf, benennt die grundlegenden Fehler und Entwicklungsresistenzen (trotz semantischer Änderungen) dieser Politik, mit ihrer Unehrlichkeit und entsprechender Entwicklungshelfer-Lobby, und plädiert für sofortiges „Innehalten und Umdenken“. Die klare Sprache, die er hier spricht, muss sich endlich in den entsprechenden Ministerien und NROs – und in den Afrika-Darstellungen vor allem der Medien und Schulbücher – durchsetzen, damit die Realsatire der Reaktionen afrikanischer Eliten auf unsere Zumutungen einmal nicht mehr heißt: Ihr tut, als ob ihr uns helft und wir tun, als ob wir uns entwickeln.“ (Jakobeit, S. 455)’

 Zurück zum Buch
Zurück zum Buch